Zur unbedingt notwendigen Verbindung von Queer & Kapitalismuskritik ist eine breitere Debatte in Gang gekommen, die es lohnt, zu verfolgen und fortzusetzen. Es erscheint mir wichtig, nicht einfach die „Wertabspaltungstheorie“ von Roswitha Scholz zur Kenntnis zu nehmen und sie dann stetig zu wiederholen, sondern damit weiterzuarbeiten! Interessant sind hierzu einerseits Überlegungen, warum es niemals im Sinne kapitalistischer Produktionsweise (kapitalistischer gesellschaftlicher Verhältnisse) war, alle Frauen aus der Erwerbsarbeit auszuschließen (vgl. Punkt [4] im Folgenden), sondern auch die aktuellen neoliberalen Verhältnisse zu reflektieren, diese zu verstehen und praktisches Handeln abzuleiten (hierzu [4] und [5] im Folgenden). Die Antworten werden intersektional sein müssen – warum wird bei der Lektüre von [6] deutlich. Nun die entstandene Diskussion:
1) Dieser Beitrag löste die Debatten aus: „Diverser leben, arbeiten und Widerstand leisten – Queerende Perspektiven auf ökonomische Praxen der Transformation“ (Kathrin Ganz, Do. Gerbig)
2) Es erschien darauf hin diese Kritik: „Queerfeministische Ökonomiekritik? Eine Randnotiz zum Ende des Kapitalismus“ (Salih Alexander Wolter)
3) Hier wurde diese Kritik noch einmal unterlegt: „Weg mit dem Queer-Ding! Ansätze für eine queere Kapitalismuskritik“ (Heinz-Jürgen Voß)
4) Es gilt sehr grundsätzlich die Verwobenheit von Geschlecht und Kapitalismus zu verstehen – unter anderem warum Kapitalismus stets auch auf Frauenarbeit zielte und warum die Differenzierung in zwei Geschlechter so gut nutzbar ist: Geschlecht und kapitalistische Produktionsweise – Queer und Antikapitalismus: Skizzen für neue Perspektiven (Heinz-Jürgen Voß)
5) Einige weitere wichtige Überlegungen, wie wir weiterdenken und eine Praxis entwickeln können, finden sich hier: a) In diesen Arbeiten von Volkmar Sigusch (u.a. „Die Mystifikation des Sexuellen“). b) In diesem zentralen Aufsatz von Nancy Peter Wagenknecht („Formverhältnisse des Sexuellen“). c) In dem von Heike Friauf hrsg. Band „Eros und Politik“, dort u.a. der Beitrag von Leo Kofler „Eros, Ästhetik, Politik – Thesen zum Menschenbild bei Marx“.
6) Das Buch „Queer und (Anti-)Kapitalismus“ (von Heinz-Jürgen Voß / Salih Alexander Wolter; Stuttgart 2013: Schmetterling Verlag)
7) Perihan Mağdens Roman „Ali und Ramazan“ macht sehr gut literarisch klar, dass und wie ökonomische und sexuelle Fragen in Verbindung stehen (also: „Intersektionalität“!). Die Autorin stellt ihrem Buch ein Zitat voran: „Leute, die über Revolution reden, oder über Klassenkampf, ohne sich dabei explizit auf das alltägliche Leben zu beziehen, die nicht verstehen, was subversiv an der Liebe ist und was positiv ist an der Zurückweisung von Beschränkungen, solche Leute haben eine Leiche in ihrem Mund.“ Rezensionen, die die Anschlussmöglichkeiten für Queer & Kapitalismuskritik umreißen, finden sich hier und hier.


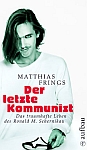 Ronald. M. Schernikau, geboren 1960 in Magdeburg, ging 1965 mit seiner Mutter in den Westen. Mit 19 Jahren veröffentlichte er die ‚Kleinstadtnovelle‘ – diese Geschichte über Coming Out in der Provinz wurde sein erfolgreiches Debüt. Nach dem Abitur zog er nach Berlin, lernte dort unter anderem Mathias Frings und die Westberliner Polit- und Schwulenszene kennen. Jedoch versuchte er weitgehend erfolglos einen Verlag für seine späteren Arbeiten zu finden. 1987 gelang es ihm, in der DDR, am Leipziger Literaturinstitut Johannes R. Becher, zu studieren. Als Abschlussarbeit entstehen „Die Tage in L“. In der DDR werden sie nicht gedruckt, ihr Erscheinen im Westen fällt mit dem Fall der Mauer zusammen. Im September 1989 wird Schernikau DDR-Bürger, arbeitet an der „Legende“ – seinem Hauptwerk. 1991 stirbt Ronald M. Schernikau mit 31 Jahren an AIDS.
Ronald. M. Schernikau, geboren 1960 in Magdeburg, ging 1965 mit seiner Mutter in den Westen. Mit 19 Jahren veröffentlichte er die ‚Kleinstadtnovelle‘ – diese Geschichte über Coming Out in der Provinz wurde sein erfolgreiches Debüt. Nach dem Abitur zog er nach Berlin, lernte dort unter anderem Mathias Frings und die Westberliner Polit- und Schwulenszene kennen. Jedoch versuchte er weitgehend erfolglos einen Verlag für seine späteren Arbeiten zu finden. 1987 gelang es ihm, in der DDR, am Leipziger Literaturinstitut Johannes R. Becher, zu studieren. Als Abschlussarbeit entstehen „Die Tage in L“. In der DDR werden sie nicht gedruckt, ihr Erscheinen im Westen fällt mit dem Fall der Mauer zusammen. Im September 1989 wird Schernikau DDR-Bürger, arbeitet an der „Legende“ – seinem Hauptwerk. 1991 stirbt Ronald M. Schernikau mit 31 Jahren an AIDS.